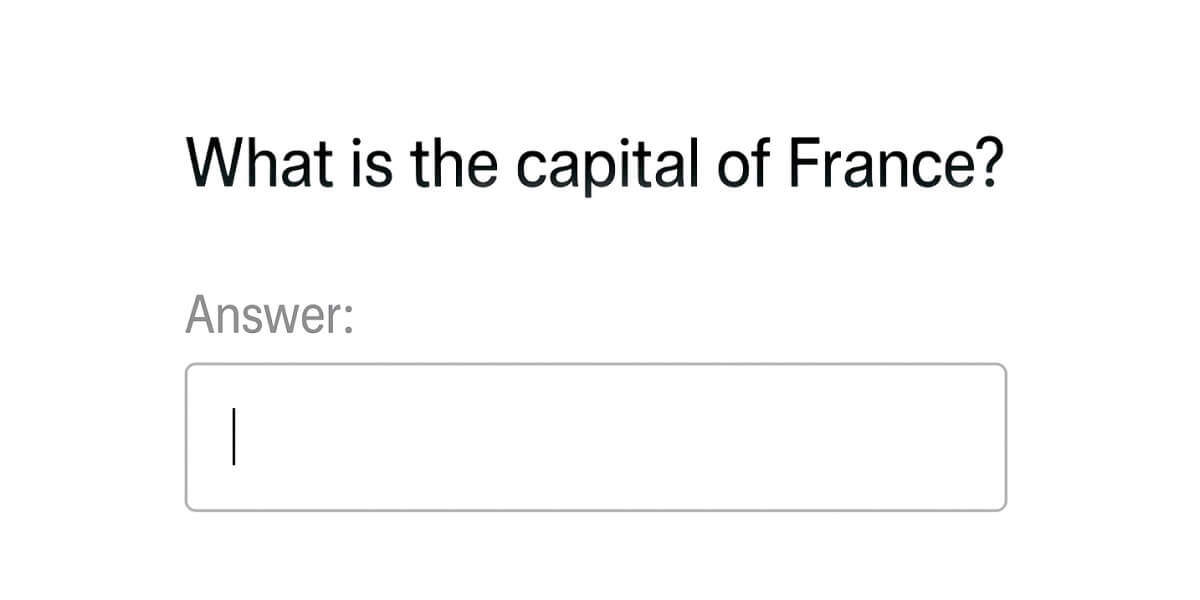
Wer hat Angst vor der Online-Klausur?
Alles digital - auch die Prüfung. Was anfangs nach einer cleveren Lösung für den Bildungsalltag klingt, wird bei genauerem Hinsehen zur Streitfrage.

Prüfungsstart am Küchentisch - und gleich im Nachteil?
Klassenzimmer gibt es nur noch auf dem Bildschirm. Wenn die Prüfung startet, sitzen manche an einem höhenverstellbaren Schreibtisch mit Noise-Cancelling-Kopfhörern. Andere am Küchentisch mit Geschwistern im Hintergrund. Wer schon bei der Umgebung verliert, hat es schwer, sich voll auf die Aufgabe zu konzentrieren.
Hinzu kommen technische Unterschiede: Ein schneller Laptop ist kein Standard. Und während manche auf Glasfaser setzen, wackelt andernorts das WLAN. Allein diese Unterschiede zeigen: Die digitale Prüfung beginnt nicht bei null - sondern mit Startvorteilen und Stolperfallen.
Fair ist das nicht. Und es zeigt: Gerechtigkeit in digitalen Prüfungen beginnt nicht erst mit der ersten Frage, sondern beim Zugang zur Technik.
Gleiche Fragen - aber nicht dieselben Chancen
Stell dir zwei Schüler vor. Beide haben den gleichen Lernstoff geübt. Beide schreiben die gleiche Online-Klausur. Doch während der eine im ruhigen Arbeitszimmer sitzt, kämpft der andere mit Lärm, einem alten Gerät und plötzlichen Systemabstürzen. Können beide ihr Wissen gleich gut zeigen?
Objektiv gesehen: Nein. Denn die Prüfungsleistung wird vom Umfeld beeinflusst. Schon eine fünfsekündige Unterbrechung kann die Konzentration ruinieren. Bei Zeitdruck und Kameraüberwachung kann so etwas den Unterschied zwischen bestanden und durchgefallen bedeuten.
Besonders kritisch wird es, wenn Prüfungen den Ausgang von Schulabschlüssen oder Studienplätzen mitbestimmen. Dann wird aus einem technischen Problem ein bildungspolitisches.
Betrug oder Ungleichheit - was wiegt schwerer?
Ein Hauptargument für Online-Prüfungen sind automatische Überwachungstools. Sie sollen Betrug verhindern. Doch was, wenn diese Tools selbst unfair sind?
Algorithmen erkennen „auffälliges Verhalten“ - aber was heißt das? Wer nervös blinzelt, den Blick schweifen lässt oder eine andere Hautfarbe hat, wird häufiger als „verdächtig“ markiert. Studien zeigen, dass solche Systeme diskriminieren können. Das Problem: Diese Fehlalarme bleiben oft unerkannt oder führen sogar zu Konsequenzen.
Gleichzeitig lässt sich Betrug trotz Überwachung nicht ganz verhindern. Wer betrügen will, findet Wege. Doch die Technik trifft nicht nur Betrüger - sondern auch Unschuldige. Das schafft kein Gefühl von Fairness, sondern von Misstrauen.
Wer darf überhaupt mitmachen?
In vielen Ländern ist der Zugang zur digitalen Prüfung eine Frage des Geldbeutels. Wer keine passende Technik besitzt, wird ausgeschlossen oder muss auf Schulungsangebote verzichten. Auch Menschen mit Behinderungen stoßen oft auf Barrieren. Nicht jede Prüfungssoftware ist barrierefrei, nicht jede Aufgabe für alle gleich lösbar.
Die Lösung? Mehr Unterstützung, mehr Vorbereitung, mehr Rücksicht. Aber das braucht Zeit, Geld und politische Entscheidungen. Bis dahin bleibt die Fairness auf der Strecke.
Auch der Faktor Sprache darf nicht unterschätzt werden. Für viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind Prüfungsanweisungen in Fachsprache ein zusätzliches Hindernis. In analogen Prüfungen hilft oft ein kurzer Blickkontakt oder eine Rückfrage. Online? Fehlanzeige.
Von Fehlern lernen - oder durchfallen?
Ein technisches Problem mitten in der Prüfung - und dann? In manchen Fällen darf die Prüfung wiederholt werden. In anderen zählt sie als Fehlversuch. Das hängt von der Schule, der Hochschule oder dem Bundesland ab. Einheitliche Regeln fehlen oft.
Hinzu kommt: Viele Online-Prüfungen lassen keinen Platz für offene Fragen oder kreative Lösungen. Sie setzen auf Multiple Choice oder kurze Antworten, die maschinell ausgewertet werden können. Wer anders denkt oder mehr erklären will, hat das Nachsehen.
Das ist nicht nur unfair, sondern auch pädagogisch fragwürdig. Denn Lernen bedeutet mehr als nur das richtige Kreuz zu setzen.
Die technische Komplexität solcher Prüfungen kann auch auf Seiten der Lehrkräfte zum Problem werden. Wer eine digitale Prüfung erstellt, muss nicht nur die Inhalte kennen, sondern auch die Plattform verstehen, die Regeln kennen und auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Fehler in der Aufgabenstellung oder fehlerhafte Bewertung durch Algorithmen kommen vor - und sind schwer nachvollziehbar.
Zwischenlösung oder Zukunftsmodell?
Manche sehen digitale Prüfungen als Übergangslösung - andere als festen Bestandteil moderner Bildung. Klar ist: Ganz ohne digitale Elemente wird es künftig nicht gehen. Aber das heißt nicht, dass jede Prüfung online stattfinden muss.
Hybride Modelle könnten ein Ausweg sein. Vorbereitungen und Übungsphasen digital, die eigentliche Prüfung vor Ort. Oder individuell angepasste Formate je nach Bedarf. Auch mündliche Prüfungen per Videokonferenz könnten fairer sein - weil sie direkter sind und weniger anfällig für technische Tricks.
Doch all das setzt voraus: eine gute Planung, klare Regeln und den Mut, Prüfungen neu zu denken.
Dazu gehören auch realistische Zeitfenster. In digitalen Prüfungen wird häufig unterschätzt, wie viel Zeit einfache Navigation kostet. Zwischen Aufgaben wechseln, technische Hinweise lesen, Formatierungen verstehen - all das frisst Minuten. Wer zu knapp kalkuliert, bewertet nicht Wissen, sondern Schnelligkeit.
Und was ist mit der Chancengleichheit?
Die große Frage bleibt: Wie lässt sich Chancengleichheit sichern, wenn die Bedingungen so verschieden sind? Die Antwort ist unbequem: Nur mit Ausgleich. Wer zu Hause keine guten Bedingungen hat, braucht Alternativen. Schulen und Hochschulen könnten Räume bereitstellen, Technik verleihen oder individuelle Prüfungsformen anbieten.
Doch bisher passiert das zu selten. Stattdessen wird vorausgesetzt, dass alle sich irgendwie anpassen. Das ist nicht fair - und auch nicht zukunftsfähig.
Ein Blick auf die Praxis zeigt: Dort, wo es faire Regelungen gibt, werden sie angenommen. Studierende, die etwa einen Wiederholungsversuch nach technischen Problemen bekommen, berichten von mehr Vertrauen und weniger Druck. Und auch Lehrkräfte profitieren - weil weniger Konflikte entstehen.
Ein weiterer Aspekt ist die psychologische Belastung. Die ständige Kameraüberwachung, die Unsicherheit bei technischen Problemen, das Gefühl, beobachtet zu werden - all das erhöht den Stress. Prüfungsangst wird nicht weniger durch digitale Formate, im Gegenteil. Wer gereizt oder überfordert ist, kann sein Wissen oft nicht abrufen. Die Folge: schlechtere Noten, obwohl die Leistung eigentlich da wäre.
Was wäre, wenn Fairness neu gedacht wird?
Vielleicht müssen wir Prüfungen ganz anders sehen. Nicht als Kontrolle, sondern als Teil des Lernprozesses. Dann wäre die zentrale Frage nicht mehr: „Wie verhindere ich Betrug?“, sondern: „Wie ermögliche ich echte Leistung?“
Digitale Prüfungen könnten Feedback geben, Lernwege sichtbar machen, Schwächen aufdecken - ohne gleich zu bewerten. Das braucht andere Tools, andere Formate und eine andere Haltung.
Fairness ist dann nicht mehr nur ein Ziel - sondern der Maßstab für alles.
Gerechtigkeit heißt nicht: Alle haben das Gleiche. Gerechtigkeit heißt: Jeder bekommt, was er braucht, um zeigen zu können, was er kann. Genau da müssen digitale Prüfungen hin.
Und vielleicht geht es dann nicht mehr darum, ob Online-Klausuren fair sein können, sondern darum, wie wir sie fair machen. Denn nur dann erfüllen sie ihren Zweck: nicht zu sortieren, sondern zu fördern.


